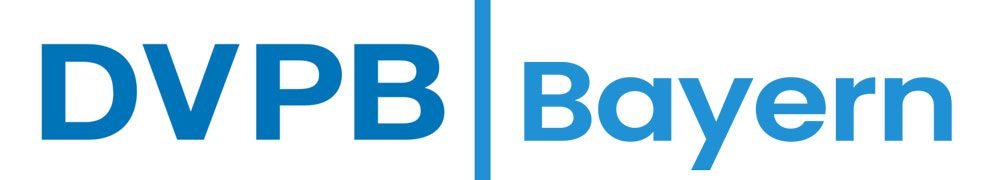Warum das Engagement gegen Rassismus und Antisemitismus so herausfordernd ist: Julia Bernstein, Marian Offman und Ludwig Spaenle diskutieren bei der DVPB-Jahrestagung 2022
Dass Rassismus und Antisemitismus auch in Bayern weiter um sich schlagen, berichtete bei der DVPB-Jahrestagung mit Dr. Ludwig Spaenle der Beauftragte der bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, für Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe. Im Zusammenhang mit den Entschädigungszahlungen für die Hinterbliebenen des Olympia-Attentates von 1972 erhält Spaenle derzeit regelmäßig Drohungen gegen seine Person und vor allem antisemitische Hetze in sein E-Mail-Postfach. Die Feindlichkeit gegenüber Jüdinnen und Juden suche sich immer neue Erklärungsmuster. Verschwörungsmythen aktualisierten sich regelmäßig – nicht zuletzt durch den Umgang mit der Corona-Pandemie – und würden so anschlussfähig nicht mehr nur in rechtsextremen Kreisen.
Schutz jüdischen Lebens als Staatsziel
„Noch immer sind Menschen jüdischen Glaubens in ihrer Lebensweise eingeschränkt und durch ätzenden, gewaltbereiten Hass bedroht“, sagt Spaenle, der mit Blick auf Veranstaltungen wie die DVPB-Jahrestagung ergänzte: „Am Ende von Netzwerktreffen und Tagungen ist man erst entsetzt, dann entrüstet.“ Und dann? Sich unterschwelligem, sich in scheinbar unbedachten Äußerungen zeigenden, oder auch dem organisierten Antisemitismus entgegenzustellen, sei Aufgabe eines und einer jeden Einzelnen. Gemeinsam geht es jedoch besser: Als Beauftragter der Staatsregierung schüttelt Spaenle Hände, kooperiert mit den unterschiedlichsten Verbänden, spricht mit ehrenamtlich Tätigen und Entscheider*innen in der öffentlichen Verwaltung, organisiert Veranstaltungen, informiert über jüdischen Glauben und Kultur, klärt auf über Israel-zentrierten Antisemitismus – die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Ein konkretes Ziel seiner politischen Arbeit ist dabei, den Schutz jüdischen Lebens und die Bekämpfung des Antisemitismus als Staatsziel in die Bayerische Verfassung aufzunehmen, und natürlich auch ins gesamtdeutsche Grundgesetz.
„Unerträgliche Dauerschleifen“
„Jenseits von Sonntagsreden: Herausforderungen beim Engagement gegen Antisemitismus und Rassismus“ lautete der Beitrag von Prof. Dr. Julia Bernstein (Frankfurt University of Applied Sciences), in dem sie zuerst auf diskursive Dauerschleifen zur Ächtung von Antisemitismus und Rassismus einging. Wenn also auf Angriffe, Aufmerksamkeit und Berichterstattung immer die politische Ächtung und immer neue Diskussionen über verschiedene, scheinbar überraschende Ausgestaltungen des Antisemitismus folgen – dann ist das für die Betroffenen nicht nur ermüdend, sondern hinterlässt das schlichtweg unerträgliche Gefühl, dass sich nichts ändert.
Antisemitismus als Teil des Zeitgeistes zeige sich in Phänomenen wie der Opferkonkurrenz zwischen Antisemitismus und Rassismus, der Gleichsetzung zwischen Antisemitismus und Rassismus, einem Antirassismus mit antisemitischen Tendenzen oder der Vermischung der politischen Diskussion über die Politik des israelischen Staates mit antisemitischen Motiven. Zusammenfassend ließ sie ein Zitat des Soziologen David Hirsh aus dem Jahr 2017 für sich sprechen: „Jeder Antisemitismus kritisiert den, der vor ihm kam. Wilhelm Marr sagte schon Ende des 19. Jahrhunderts, christlicher Antisemitismus sei eigentlich lächerlich, man müsse aber verstehen, was das Problem mit den Juden nun sei. In ähnlicher Weise sagt das, was heute ‚neuer Antisemitismus‘ genannt wird: ‚Klar, wir sind gegen den alten, faschistischen, also den echten Antisemitismus, aber gleichzeitig sind es die Juden und Zionisten, die heute verantwortlich für Krieg und Elend und viel, viel mehr sind‘.“
Wo bleibt die Empathie?
Marian Offman ist Beauftragter der Landeshauptstadt München für den interreligiösen Dialog, Vorstandsmitglied der jüdischen Gemeinde Münchens und war über viele Jahre Mitglied im Münchner Stadtrat. Was ihn offensichtlich mehr beschäftigt als die Neonazis, denen er sich seit Jahrzehnten bei Demonstrationen gegenüberstellt, ist „das Subtile am Antisemitismus“, ist das, was sich im täglichen Leben und Erleben in die Gesellschaft einschleicht: Dass ihm in scheinbar vorauseilendem Gehorsam vor dem öffentlichen Aufschrei die Stellung als (jüdischer) Antisemitismusbeauftragter der Stadt München verwehrt blieb; oder dass antisemitische Plakate aus der NS-Zeit, die aus hetzerischer Absicht neu adaptiert und gezeigt werden, vor Gericht als von der Meinungsfreiheit gedeckte Karikatur interpretiert werden. Der deutschen Gesellschaft attestiert Offman infolge der Shoah eine „kollektive Psychose. Ein junger jüdischer Mensch hat immer das Gefühl, dass er – aufgrund der Geschichte seiner Eltern, seiner Großeltern, der Geschichte in diesem Land – ständig diskriminiert wird. Und die Gesellschaft sollte so viel Empathie aufbringen, dass sie dieses Gefühl akzeptiert. Der Makel dieses, unseres Landes wird so lange bestehen, wie unsere Gesellschaft diese Empathie nicht aufbringt.“
Antisemitische Hetze ist keine Meinung
Auf dem Podium entspann sich eine intensive Diskussion über Rechtsprechung und fehlende bindende Definitionen darüber, was antisemitische Straftaten tatsächlich ausmacht. Wie kann es sein, dass ein Molotow-Cocktail, der auf eine Synagoge geworfen wird, lediglich eine Sachbeschädigung darstellt? Dass online – trotz aller aktuellen Initiativen wie einem Hate-Speech-Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung – praktisch jeder antisemitische Mist verbreitet werden kann? „Menschenrechte stehen über der Meinungsfreiheit“, meint Julia Bernstein. „Wir reden über so viele berechtigte Spielarten von Menschenrechten in Deutschland, aber viel zu selten über die der jüdischen Personen.“
Auch auf die wichtige Arbeit mit den letzten Zeitzeuginnen und Zeitzeugen der Shoah wiesen die Podiumsgäste hin. Marian Offman mahnt an, die Erinnerung an diese Personen aufrecht zu erhalten, „jede Ecke der Erinnerung auszuleuchten“ – und sich dennoch auf die aktuelle kulturelle Begegnung zu konzentrieren. Auch der Ludwig Spaenle sagt: „Irgendwann wird der Moment da sein, an dem die letzten Überlebenden der Shoah gestorben sind. Dann kommt es darauf an, mit zeitgemäßen medialen Formaten die Erinnerung modern zu halten, und bis dahin die Dokumentationspflicht zu erfüllen, wann und wo immer es geht.“
Gefährlich werde es für die gesamte Gesellschaft, wenn sich in einem ritualisierten, abstrakten Gedenken niemand mehr als Nachfahre der Täter der Shoah positioniere. „Man kann sich nicht gegenüber den letzten verbliebenen Zeitzeugen Katharsis-gleich ausweinen, und dann bei antisemitischen Vorfällen wegsehen“, meint Spaenle. Und Offman ergänzt: Ob unter diesen Voraussetzungen in 50 Jahren noch jüdische Menschen in Deutschland leben wollten, vermöge er nicht zu sagen.
Sebastian Haas